Die Annakirche ist eine römisch-katholische Ordenskirche in der Annagasse 3b im 1. Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt
und gilt als eine der schönsten Barockkirchen der Stadt. |
Die einschiffige Saalkirche mit ihrem basilikalen Querschnitt besitzt Gurttonnengewölbe mit Stichkappen,
einen eingezogenen Chor und beiderseits drei Kapellen, von denen nur die erste links über ovalem Grundriss größere Ausmaße hat (Franz-Xaver-Kapelle,
angeblich die alte Annakapelle, 1679 umgebaut). |
|
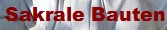 |
| Kirche: |
| Gebäude, das zum Abhalten christlicher Rituale vorgesehen ist |
| |
|
| |
| Dom: |
| großes Kirchengebäude |
|
Die Barockisierung des Kircheninneren (seit 1715) stand unter der Leitung des Jesuitenfraters und Malers Christoph Tausch,
eines Schülers von Andrea Pozzo, unter Mitarbeit von Daniel Gran und Johann Georg Schmidt. Gran schuf das Hochaltarbild Heilige Familie. |
Die vergoldeten Figuren sollen laut Beschreibung der Kirche die Heiligen Karl Borromäus beziehungsweise Rochus darstellen. |
Bild oben links: Der Chorraum ist vom Rest der Kirche durch eine Art Triumphbogen abgeteilt, dessen linken Teil eine Skulptur von Anna und Maria bildet.
Video oben: Ein visueller Rundgang durch die Wiener Annakirche. |
Bild oben links: Die Glorie der Gottesmutter: Den Grund der himmlischen Herrlichkeit der Gottesmutter zeigt das Emblem JESUS im Strahlenkranz.
Bild oben rechts: Die Glorie der hl. Anna. Den Grund ihrer Glorie zeigt das Emblem MARIA, das in einem Strahlenkranz aufleuchtet. |
|
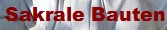 |
| Taufbecken: |
| Ein wichtiger Ort in einer Kirche ist der Taufbrunnen. Es ist der Ort, an dem das Christsein seinen Anfang nimmt. Dort beginnt normalerweise die volle sakramentale Eingliederung in die Kirche, zu der die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie gehören. |
| |
|
| |
| Weihrauch: |
| „Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf ...“ Dieser Vers aus dem Psalm 141 versinnbildlicht, welche Funktion die Verwendung von Weihrauch in der Liturgie hat: Das Aufsteigen der Rauchschwaden soll unser Gebet an Gott verdeutlichen. Gleichzeitig ist Weihrauch auch Zeichen der Verehrung. |
|
Bild oben links: In der Josefskapelle zeigt das Altarbild Josef, der mit Hilfe des Christuskindes einem Pilger einen Brief ausstellt.
Das Bild wurde 1719 von Johann Georg Schmidt gemalt. |
Mitte 18. Jahrhundert entstanden auch Kanzel und Orgel. Stuckmarmorverkleidung und Vergoldung geben dem Innenraum ein festliches Gepräge. |
Im 19. Jahrhundert erhielt Anna jedoch ihre Kapelle zurück. Allerdings zeigen die Wandbemalung, sowie das Deckenfresko Bilder, die auf Franz Xaver bezogen sind, hauptsächlich auf seine Missionstätigkeit. |
Bild oben mitte: Auch auf dem Altartisch gibt es ein Bronzerelief, das den Missionar bei der Heidentaufe zeigt. Auf Anna deutet eigentlich nur die Holzskulptur,
die "Anna Selbdritt" zeigt. Der Ausdruck "Anna Selbdritt" bedeutet, dass es eine Abbildung der Anna mit ihrer Tochter Maria und ihrem Enkel Jesus ist.
Die Statue entstand um 1505 und ist dem Umkreis von Veit Stoß zugeschrieben. |
Orgel wurde vor 1747 vom unbekannten Orgelbauer erbaut. 1848/1858 Umgestaltungen; 1979/80 restauriert von Helmut Allgäuer (Theresienfeld) |
Hier geht es zur Liste |
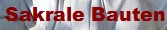 |
|
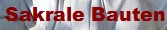 |
| Das Kreuz: |
| Das Kreuz ist das Erkennungs- und Bekenntniszeichen der Christen schlechthin. Schon in vorchristlicher Zeit besitzt es einen religiösen Charakter, doch für Christen hat es eine besondere Bedeutung. |
| |
|
| |
| Kanzel: |
| In vielen älteren Kirchen ist eine Kanzel zu finden. Meist ist sie an einem Pfeiler oder einer Längswand der Kirche angebracht, über einen Treppenaufgang zu erreichen und hat einen Schalldeckel. Entstanden ist die Kanzel im Mittelalter und hat ihren Namen von der lateinischen Bezeichnung „cancelli“ für die damals üblichen Absperrungen des Altarraums. Gefördert wurde die Entstehung durch die Predigttätigkeit der Bettelorden. |
| |
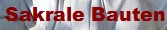 |
| |
Quellennachweis: |
| |
|
|
|
| |
|
|

