Die Wiener Karlskirche ist eine römisch-katholische Kirche im 4. Wiener Gemeindebezirk Wieden.
Sie liegt an der Südseite des zentrumsnahen Karlsplatzes und ist einer der bedeutendsten barocken Kirchenbauten nördlich der Alpen und eines der Wahrzeichen Wiens. |
Das Bild am Hochaltar, die Aufnahme des heiligen Karl Borromäus in den Himmel darstellend, ist vom älteren Fischer konzipiert
und von Ferdinand Maximilian Brokoff ausgeführt worden |
|
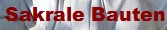 |
| Kirche: |
| Gebäude, das zum Abhalten christlicher Rituale vorgesehen ist |
| |
|
| |
| Dom: |
| großes Kirchengebäude |
|
Der Hochaltar stammt in seiner Gesamtkonzeption von J. B. Fischer von Erlach (Modell der plastischen Wolkendekoration von Ferdinand Brokoff, 1728).
Den Tabernakel bekrönt ein barockes Kruzifix, die beiden vergoldeten Engel stammen von Lorenzo Mattielli, die Stuckfigur des heiligen Karl Borromäus von Alberto Camesina;
seitlich auf dem Gebälk die vier Kirchenväter. |
Video oben: Ein visueller Rundgang durch die Wiener Karlskirche. |
Taufkapelle mit reizvoll bemalter ovaler Kuppel (Scheinarchitektur und Blumen) von Gaetano Fanti; Altarbild „Christus und der römische Hauptmann" von Daniel Gran (1736). |
|
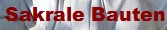 |
| Taufbecken: |
| Ein wichtiger Ort in einer Kirche ist der Taufbrunnen. Es ist der Ort, an dem das Christsein seinen Anfang nimmt. Dort beginnt normalerweise die volle sakramentale Eingliederung in die Kirche, zu der die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie gehören. |
| |
|
| |
| Weihrauch: |
| „Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf ...“ Dieser Vers aus dem Psalm 141 versinnbildlicht, welche Funktion die Verwendung von Weihrauch in der Liturgie hat: Das Aufsteigen der Rauchschwaden soll unser Gebet an Gott verdeutlichen. Gleichzeitig ist Weihrauch auch Zeichen der Verehrung. |
|
Bilder oben: Altarbild; "Jesus heilt einen Gichtbrüchigen" von Giovanni A. Pellegrini. |
Bilder oben: Altarbild; "Die Himmelfahrt Mariens" von Sebastian Ricci. |
Bild oben 1: Taufbecken. Bild oben 2: Altar; "Jesus erweckt den Jüngling in Naim", ein Bild von Martino Altomonte. Bild oben 3: Der Hl. Josef. |
Kanzel mit reich vergoldeten Ornamenten und weit übergreifendem Baldachin, auf dem Schalldeckel zwei Putten. |
Auf der Orgelempore mit ihrem Säulenvorbau befindet sich eine Barockorgel, deren Erbauer unbekannt ist.
Das mittlere Gehäuse stammt aus der Zeit um 1739. Das Instrument wurde jedoch 1847 von Joseph Seyberth grundlegend modifiziert
und mit einem freistehenden Spieltisch ausgestattet. Beide Seitenflügel stammen ebenfalls aus dieser Zeit. |
Hier geht es zur Liste |
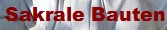 |
|
|
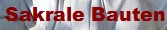 |
| Das Kreuz: |
| Das Kreuz ist das Erkennungs- und Bekenntniszeichen der Christen schlechthin. Schon in vorchristlicher Zeit besitzt es einen religiösen Charakter, doch für Christen hat es eine besondere Bedeutung. |
| |
|
| |
| Kanzel: |
| In vielen älteren Kirchen ist eine Kanzel zu finden. Meist ist sie an einem Pfeiler oder einer Längswand der Kirche angebracht, über einen Treppenaufgang zu erreichen und hat einen Schalldeckel. Entstanden ist die Kanzel im Mittelalter und hat ihren Namen von der lateinischen Bezeichnung „cancelli“ für die damals üblichen Absperrungen des Altarraums. Gefördert wurde die Entstehung durch die Predigttätigkeit der Bettelorden. |
| |
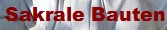 |
| |
Quellennachweis: |
| |
|
|
| |
|
|

